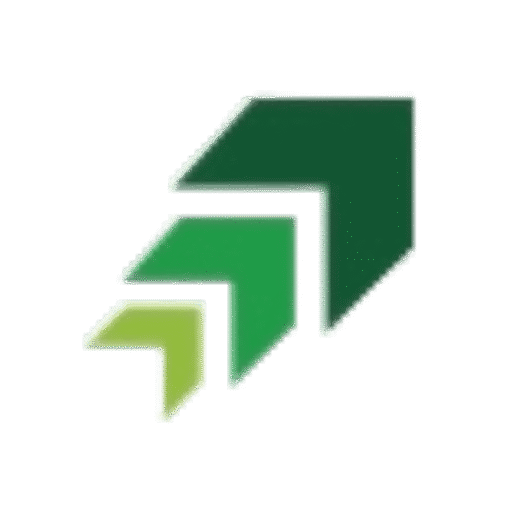Warum Struktur zählt – und was sie leistet
Kündigungen sind für ArbeitgeberInnen anspruchsvoll: Es braucht Sachlichkeit, Respekt und verlässliche Abläufe. Eine gute Struktur verhindert Formfehler, beschleunigt Entscheidungen, reduziert Konflikte und schützt die Arbeitgebermarke. In den meisten fällen lassen sich Eskalationen vermeiden, wenn Verantwortliche frühzeitig dokumentieren, Feedback geben, Alternativen prüfen und Gesprächsleitfäden nutzen. Das Ziel ist kein „hartes Durchziehen“, sondern ein nachvollziehbarer, fairer Prozess, der allen Beteiligten Orientierung gibt – von der Vorbereitung bis zur Übergabe, bis das Arbeitsverhältnis beendet ist.
Eine schlanke Governance definiert Rollen (Linie, HR, Rechtsberatung), Entscheidungsbefugnisse und Eskalationswege. Checklisten, Vorlagen für Gesprächseinladungen, Dokumentations- und Zustellnachweise schaffen Vergleichbarkeit über Standorte hinweg. Ein Fristenkalender verhindert Versäumnisse; ein Kommunikationspaket regelt, wie Vorgesetzte, Team und Betriebsrat informiert werden. Auch Retention-Optionen gehören in den Prozess: Versetzung, Qualifizierung, temporäre Zielanpassung.
Nach Abschluss sichert ein Debriefing („Lessons Learned“) Qualitätskontinuität und reduziert künftige Risiken. Führungskräfte profitieren von kurzen Trainings zu heiklen Situationen, insbesondere zu Krankenstand, Schutzgruppen und fristlose Kündigung als Ausnahme. Regelmäßige Audits der Unterlagen sowie ein zentrales, DSGVO-konformes Ablagesystem erhöhen Nachweisbarkeit und Geschwindigkeit im Streitfall.
Rechtlicher Rahmen: Was macht eine Kündigung wirksam?
Bevor Sie handeln, prüfen Sie die Zulässigkeit der Kündigung nach gesetzlichen Bestimmungen, Kollektivvertrag und Arbeitsvertrag. Dazu gehören insbesondere Kündigungsfristen und Termine (je nach Betriebszugehörigkeit, Branche und Vertrag), Sonderkündigungsschutz (z. B. Betriebsrat, Mutterschutz), sowie Form und Zustellung.
Zentral ist die schriftliche Kündigung: Sie schafft Klarheit über den Kündigungstermin, den Fristbeginn und die nächsten Schritte. Dokumentation ist Pflicht – Leistungsdaten, Abmahnungen, Gesprächsprotokolle. All das stützt die Entscheidung und hilft, die Kündigung wirksam zu gestalten. Prüfen Sie außerdem, ob eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Einvernehmen (einvernehmliche Lösung) eine tragfähige Alternative darstellt, wenn beide Seiten das möchten.
Berücksichtigen Sie zudem Besonderheiten wie Anhörungsrechte des Betriebsrats, Meldepflichten und etwaige Zustimmungserfordernisse bei besonders geschützten Gruppen. Die Zustellung sollte beweissicher erfolgen (eingeschriebener Brief, Boten, Übergabe mit Empfangsbestätigung); bei elektronischer Form nur, wenn arbeitsvertraglich tragfähig geregelt. Prüfen Sie mit Hinblick auf einen Krankenstand, ob der beginn des Krankenstandes Auswirkungen auf Entgeltfortzahlung und Termine hat; wird jemand „Krankenstandes gekündigt“, können Ansprüche fortwirken.
Die fristlose Kündigung bleibt die Ausnahme und verlangt gravierende Gründe und sofortiges Handeln. Schließlich lohnt ein Plan B: eine einvernehmlicher Auflösung im Krankenstand oder außerhalb davon – sauber dokumentiert, fair kommuniziert und mit klaren Übergaben, bis das Arbeitsverhältnis beendet ist.

Kündigung im Krankenstand: Besonderheiten richtig managen
Heikel, aber wichtig: die Kündigung im Krankenstand. Es gilt, mit Hinblick auf einen Krankenstand rechtssicher zu agieren. Entscheidend ist u. a. der beginn des Krankenstandes: Lag der Krankenstand bereits vor der Kündigung oder trat er erst danach ein?
Wurde jemand „Krankenstandes gekündigt“, bleibt der Anspruch auf Entgelt Fortzahlung unter Umständen bestehen, obwohl das Arbeitsverhältnis beendet wird. Entgeltfortzahlung ist arbeitsrechtlich zu sehen; davon getrennt sind Leistungen der Sozialversicherung (Krankengeld), die – je nach Voraussetzungen – bis zu 52 Wochen gewährt werden können.
Verwechseln Sie beides nicht. Ebenfalls möglich, aber besonders sensibel: eine einvernehmlicher Auflösung im Krankenstand. Hier müssen Freiwilligkeit, Information und sauber dokumentierte Vereinbarungen vorliegen. In komplexen Konstellationen hilft es, vorab rechtlichen Rat einzuholen, um die Zulässigkeit der Kündigung und Folgewirkungen (z. B. Restansprüche) korrekt zu bewerten.

Schritt-für-Schritt: Vom Entscheiden bis das Arbeitsverhältnis beendet ist
Vorbereitung: Fakten klären, Alternativen prüfen
Sammeln Sie belegbare Fakten (Ziele, Leistung, Verhalten), prüfen Sie Schulungs- und Versetzungsoptionen, stimmen Sie sich intern (Linie, HR, ggf. Rechtsabteilung) ab. Legen Sie Timing, Kündigungsfristen und Termine fest und prüfen Sie Sonderrechte. Gerade in den meisten fällen hilft ein klarer Maßnahmenpfad, um Konflikte zu reduzieren oder Lösungen ohne Kündigung zu ermöglichen.
Definieren Sie Rollen und Befugnisse (Vorgesetzte, HR, Betriebsrat), richten Sie einen Fristenkalender ein und bereiten Sie Gesprächsleitfäden vor. Prüfen Sie mit Hinblick auf einen Krankenstand Entgeltfortzahlung und Schutzrechte. Dokumentieren Sie Alternativen, um die Zulässigkeit der Kündigung zu untermauern.
Gespräch führen: respektvoll, klar und ohne „heißen brei“
Kündigungsgespräche sind kurz, respektvoll, unmissverständlich. Erklären Sie die Entscheidung, nennen Sie das Ende des Dienstverhältnisses, verweisen Sie auf die schriftliche Kündigung und skizzieren Sie die nächsten Schritte (Resturlaub, Übergabe, Zeugnis). Kein Herumreden um den heißen Brei – Klarheit ist fairer. Bieten Sie Raum für Fragen und achten Sie auf Würde und Vertraulichkeit.
Bestimmen Sie die Teilnehmenden vorab, reservieren Sie einen Raum und planen Sie Formulierungen. Benennen Sie Gründe sachlich, vermeiden Sie Wertungen. Übergeben Sie die schriftliche Kündigung im Gespräch, erläutern Sie Kündigungsfristen und Termine sowie Ansprechpersonen für Abrechnung und Zeugnis.
Zustellung & Dokumentation: damit die Kündigung wirksam ist
Stellen Sie sicher, dass die schriftliche Kündigung nachweisbar zugeht (Empfangsbestätigung, eingeschriebener Brief oder persönliche Übergabe). Dokumentieren Sie alles, inklusive Gesprächsnotizen und Rückfragen. So halten Sie die gesetzlichen Bestimmungen ein und minimieren Anfechtungsrisiken.
Nutzen Sie sichere Zustellwege (Einschreiben, Bote, Empfangsbestätigung) und archivieren Sie Belege zentral, DSGVO-konform. Halten Sie Datum, Uhrzeit und Teilnehmende fest. Vermerken Sie Rückfragen und Antworten. So bleibt die Kündigung wirksam nachvollziehbar und streitfest dokumentiert.
Nachbereitung & Übergabe: sauber abschließen
Regeln Sie Zugriffsrechte, Rückgaben (Hardware, Karten, Unterlagen) und die Wissensübergabe. Klären Sie die interne Kommunikation („Wer informiert wen, wann und wie?“). Erst wenn Übergabe, Abrechnung und Bescheinigungen erledigt sind, ist das Arbeitsverhältnis beendet und der Prozess vollständig abgeschlossen.
Planen Sie Offboarding-Checklisten: Zugänge sperren, Geräte und Daten übernehmen, Kunden und Team informieren. Klären Sie Resturlaub, Zeitguthaben und offene Spesen. Vereinbaren Sie Ansprechpersonen für die letzten Fragen. Erst danach ist der Übergang sauber, das Arbeitsverhältnis beendet und abgeschlossen – und dokumentiert.
Alternativen, Eskalationen und Sonderwege
Nicht jede Trennung braucht die „harte Kante“. Eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann sinnvoll sein, wenn Perspektiven auseinandergehen, aber gutes Einvernehmen gewahrt bleiben soll – auch als einvernehmlicher Auflösung im Krankenstand, sofern beide Seiten freiwillig und informiert zustimmen.
Die fristlose Kündigung ist dagegen das letzte Mittel: Sie erfordert gravierende Gründe und sofortiges Handeln. In den meisten fällen ist die ordentliche Kündigung mit Frist rechtssicherer und berechenbarer. Wo es sinnvoll ist, können Outplacement, Coaching oder interne Wechsel helfen, Verdichtung zu lösen und Kompetenz zu erhalten.
Checkliste für Arbeitgeber innen: kompakt und praxisnah
- Rechtslage prüfen: Zulässigkeit der Kündigung, gesetzlichen Bestimmungen, Kollektivvertrag, Kündigungsfristen und Termine.
- Unterlagen sammeln: Beweise, Gespräche, Abmahnungen, Zielvereinbarungen – lückenlos dokumentieren.
- Form & Zustellung: schriftliche Kündigung korrekt datieren, Frist und Enddatum nennen, Zugang nachweisen.
- Sonderfälle regeln: Kündigung im Krankenstand, Status zum beginn des Krankenstandes, ggf. „Krankenstandes gekündigt“, Anspruch auf Entgelt Fortzahlung prüfen; Sozialleistungen (bis 52 Wochen) separat betrachten.
- Optionen abwägen: Einvernehmen möglich? Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Dialog klären. Fristlose Kündigung nur bei klaren, gravierenden Gründen.
- Übergabe planen: IT-Zugänge, Geräte, KundInnen, Projekte – bis das Arbeitsverhältnis beendet ist, alles fixieren.
Disclaimer
Dieser Beitrag ersetzt keine Rechtsberatung.
Gibt es ein Verbot der Kündigung im Krankenstand?
Ein generelles Verbot besteht nicht, dennoch sind die gesetzlichen Bestimmungen und der konkrete Status mit Hinblick auf einen Krankenstand zu beachten. Je nach Situation (z. B. beginn des Krankenstandes, „Krankenstandes gekündigt“) bleibt ein Anspruch auf Entgelt Fortzahlung bestehen. Sozialversicherungsleistungen (Krankengeld) folgen eigenen Regeln und können – je nach Voraussetzungen – bis 52 Wochen laufen.
Welche Punkte machen eine Kündigung wirksam?
Rechtsgrundlage prüfen, Kündigungsfristen und Termine einhalten, schriftliche Kündigung korrekt zustellen, Zugang nachweisen und sauber dokumentieren. So wird die Kündigung wirksam und angreifbar bleibt möglichst wenig.
Wann kommt eine fristlose Kündigung in Betracht?
Nur bei besonders schweren Pflichtverletzungen und zügiger Reaktion. In den meisten Fällen ist die ordentliche Kündigung mit Frist sicherer. Lassen Sie die Zulässigkeit der Kündigung im Zweifel vorab prüfen.
Ist eine einvernehmliche Lösung besser als eine Kündigung?
Kann sie sein – etwa, wenn beide Seiten eine faire Auflösung des Arbeitsverhältnisses wollen. Auch eine einvernehmlicher Auflösung im Krankenstand ist möglich, wenn Freiwilligkeit und Information sichergestellt sind. Wichtig: klare Vereinbarung, korrekte Abrechnung, geordnete Übergabe, bis das Arbeitsverhältnis beendet ist.